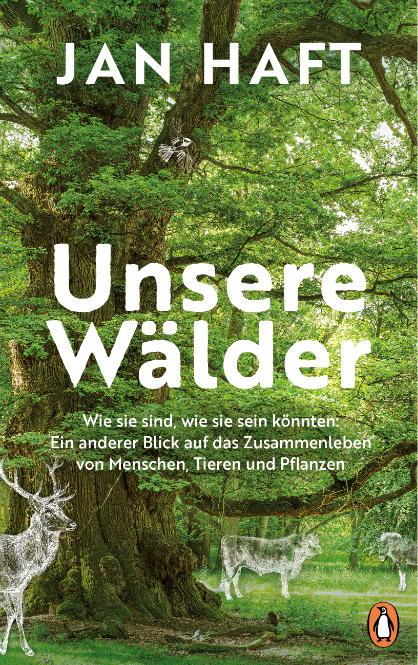Was erlebt man eigentlich, wenn man in einen unserer Wald-Nationalparke wandert, wenn man dem werbenden Rufen des hessischen Kellerwalds folgt und »Abtauchen« will »ins Buchenmeer«? Wenn man also eine Wanderung macht, hinein in die hallenhohen Buchenbestände? Zu sehen gibt es da mächtige Stämme und im Frühjahr auch viele Blüten am Boden. Die verschwinden aber bald in schummerigem Licht, wenn die Buchen das Blätterdach ganz da oben geschlossen haben. Dann gibt es unten hauptsächlich das welke Laub vom Vorjahr zu sehen. Und zu hören gibt es auch eher wenig. Ein fernes Flugzeug vielleicht. Aber das Vogelkonzert? Das Rascheln der Tiere, das Huschen? Fehlanzeige.
Wenn man tief drin ist im Buchenwald, dann ist es still. Die Tiere wollen offenbar nichts wissen vom Weltnaturerbe. Das liegt daran, dass der Buchenwald alles andere als ein artenreiches Biotop ist. Unter dem geschlossenen Blätterdach des Buchenwaldes lebt nicht viel, außer Buchen. Mitnichten beherbergen die Buchen-Nationalparke Hainich und Kellerwald »Europas ursprüngliche Wildnis«. Sie sind vielmehr das Ergebnis einer jahrtausendelangen Ausrottungskampagne unserer Vorfahren gegen die großen Tiere Europas: die Mammuts, die Waldelefanten, die Auerochsen — und auch die einst gewaltigen Herden von Rentieren und anderen Hirschen.
Unsere Wälder
Hier geht es dieses Mal um die Wiederherstellung der eigentlichen natürlichen Landschaft Mitteleuropas – und ganz nebenbei um die Produktion vorzüglicher Lebensmittel. Und das im Wald, allerdings in einem, der ganz anders ist als der Buchenwald. Es geht um einen Wald, der vor Leben strotzt, der Heimat der Artenvielfalt ist, und Klima- und Bodenschutz auch noch.
Es geht um den Wald, den Joseph von Eichendorff besungen hat:
O Täler weit, o Höhen,
O schöner, grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächt′ger Aufenthalt!
Wenn man im Netz nach Eichendorffs berühmtem Gedicht »Abschied« sucht, gemeint ist der Abschied vom Wald, dann findet man neben Mendelssohns Chorfassung auch Schauspieler, die das Gedicht vorlesen. Fritz Stavanger zum Beispiel. Und dessen YouTube-Video ist dann bebildert mit den romantischen Klassikern von Caspar David Friedrich. Und die zeigen mitnichten geschlossenen Hochwald; wohl auch, weil es den vor zweihundert Jahren kaum gab. Entsprechend ist vom Schweigen im Walde bei Eichendorff auch nicht die Rede.
Wenn es beginnt zu tagen,
Die Erde dampft und blinkt,
Die Vögel lustig schlagen,
Daß dir dein Herz erklingt:
Da mag vergehn, verwehen
Das trübe Erdenleid,
Da sollst du auferstehen
In junger Herrlichkeit!
»O schöner Weide-Wald« habe ich diesen Blog überschrieben – in Anlehnung an Eichendorffs Vers. Denn darum geht es heute: Wie wir mit ganz einfachen Mitteln, mit der Hilfe unserer Tiere nämlich, die Wälder wieder beleben. Nicht um Urwälder aus ihnen zu machen, wie es sie nur in unserer Vorstellung gibt, wie es sie hier in Mitteleuropa aber wahrscheinlich nie gab, sondern um sie wieder anzureichern mit Leben, um sie zum Hort von Biodiversität zu machen, von Artenvielfalt. Und um ihnen zu helfen, in der Klimakrise zu bestehen.
Angeregt hat diesen Blog das jüngste Buch des Naturfilmers Jan Haft. Es heißt schlicht, aber nicht einfach: »Unsere Wälder«. Nicht einfach, weil schon der Untertitel »Wie sie sind, wie sie sein könnten« darauf verweist, dass es unseren Wäldern besser gehen könnte. Das Cover zeigt unter dem Foto einer riesigen alten Eiche schemenhaft gezeichnet einen Rothirsch und – oh Wunder – im Hintergrund ein Rind und ein Pferd. Das zeigt schon, wo es hingeht, in die Wald-Weide nämlich.
Ohne Ziel und Ende
»Natur ist ein dynamisches Gefüge«, sagt Jan Haft, »alles was lebt und sich vermehrt, hat auch seine Widersacher.« Es gibt Jäger und Gejagte, Schmarotzer und Profiteure. Es sei aber nicht nur ein Gegeneinander, auch ein Miteinander. Einer der Filme, die parallel zum Buch über »Unsere Wälder« für »Erlebnis Erde« entstanden sind, heißt im Untertitel »Das Netzwerk der Tiere«. Auch die Bäume hatten einmal ihre Widersacher – die großen Pflanzenfresser, sagt der Biologe Jan Haft: »Ohne Widersacher neigen die Bäume dazu, sich im Konkurrenzkampf mit sich selbst zu messen. Dann überleben die Stärksten von nur wenigen Baumarten und dann geht die Vielfalt im Wald flöten.«
Natur ist dynamisch und kennt keinen Stillstand. Schon deshalb ist ein reiner Buchen-Hochwald auch kein natürlicher Zustand, schon gar kein Endzustand, wie uns die Lehrmeinung der Forstwirtschaft weißmachen will. Und wie es viele Naturschützer propagieren, die dem Motto »Natur Natur sein lassen« frönen.
Die Idee, dass sich echte mitteleuropäische Natur von selbst wiederherstellt, wenn die Menschen schlicht nichts mehr tun, ist nicht neu. Johann Heinrich Cotta, einer der Begründer der Forstwirtschaft, einer urdeutschen Wissenschaft übrigens, schrieb 1828 in der Vorrede zu seiner »Anweisung zum Waldbau«:
»Wenn die Menschen Deutschland verließen, so würde dieses nach 100 Jahren ganz mit Holz bewachsen seyn.«
Viele Förster und viele Naturschützer glauben das bis heute. Ob-wohl schon Johann Heinrich Cotta damals wohl einen leisen Zweifel hegte, ob der geschlossene Hochwald an sich wohl die eigentlich fruchtbare vielfältige Natur sei, denn er schrieb über das Holz:
»Da nun letzteres niemand benutzte, so würde es die Erde düngen, und die Wälder würden nicht blos größer, sondern auch fruchtbarer werden.«
Das ist die Idee von Wald, von der Jan Haft eben sagt, dass sie glücklicherweise so langsam bröckele. Die Apologeten der so genannten Klimax-Theorie, die postulieren, dass der Endzustand der heimischen Natur der geschlossene Hochwald sei, haben nämlich die Gegenspieler der Bäume schlicht ausgeblendet: die großen Pflanzenfresser.
Schon der Gedanke, dass es einen Endzustand der Natur geben kann, ist im Prinzip widernatürlich. Es gibt in der Natur jede Menge Anfänge, aber keinen Endzustand. Auch der Tod ist kein Ende, weil aus dem gestorbenen Organismus jede Menge neues Leben entsteht.
Die großen Pflanzenfresser, die die Klimax-Theorie mit ihrer Idee vom flächendeckenden Hochwald ausblendet, sind systemisch für unsere Natur, sagt Jan Haft. Europa war flächendeckend von großen Pflanzenfressern besiedelt, bis unsere Vorfahren sie dezimierten und ausrotteten.
»Die Leute müssen verstehen, das ursprünglich nicht Afrika der Kontinent der großen Tiere ist«, sagt Jan Haft. Dort seien nur weniger große Pflanzenfresser ausgerottet worden. In Afrika waren das nur zwei Arten, in Europa waren es zwölf Tierarten, die über eine Tonne schwer wurden. In Amerika waren das sogar 29 Tierarten mit über einer Tonne Lebendgewicht. Die sind alle innerhalb von rund siebenhundert Jahren verschwunden, nachdem die Menschen durch die damals trocken liegende Beringstraße ins heutige Alaska einwanderten.
Wichtig ist Jan Haft, dass wir begreifen: »Die großen Tiere sind systemisch für die Welt, sie sind systemisch für die Erde, sie sind systemisch für alle Lebensräume, sogar für die marinen, wo die Wale eine riesige Rolle spielen beim Kohlenstoffkreislauf.«

Wald und Bäume
Sind Wälder auch systemisch? Für die Regenwaldgebiete der Erde sicher. Dort sind die Wälder auch belebt und voller Artenvielfalt. Aber sind sie das auch in Mitteleuropa, gar in Deutschland, wo der geschlossene Hochwald artenarm ist, eine Monokultur?
Was ist eigentlich unsere Definition von Wald? Wikipedia sagt: »Die Definition von Wald ist notwendigerweise vage und hängt vom Bedeutungszusammenhang ab.« Dann zitiert das Lexikon ein forstliches Lehrbuch, wonach es sich um eine Pflanzenformation handelt, die » im Wesentlichen aus Bäumen aufgebaut ist und eine so große Fläche bedeckt, dass sich darauf ein charakteristisches Waldklima entwickeln kann«. Auch diese Definition eher vage. Das kann der dichte Buchenwald sein. Das kann aber auch ein lichter Wald sein, vielleicht gar eine Aneinanderreihung von Lichtungen.
Dafür spricht, dass in unseren Breiten die Ränder das Lebendigste am Wald sind, oder eben die Lichtungen. Jan Haft gibt zu bedenken, dass die meisten heimischen Baumarten im dichten Hochwald überhaupt nicht leben können. Und auch all die Tiere nicht, selbst wenn ihre Namen mit dem Wort Wald beginnen. Die Waldschnepfe ist mitnichten ein Vogel dichter Wälder, sie brütet in feuchten Laub- und Mischwäldern mit vielen Lichtungen. Der Waldkauz brütet gerne in Parks und bevorzugt dabei Eichen, die es im dichten Wald mit geschlossenem Kronendach nicht gibt. Das Waldbrettspiel, einer unserer Augenfalter, lebt in lichten Wäldern, seine Raupen fressen an Gräsern, die es im dichten Buchenwald nicht gibt.
Jan Haft erzählt von einer Reise in einen der größten Buchenwälder Europas: Zehntausend Hektar groß, ein sogenannter Urwald, der zumindest seit 250 Jahren keine Axt mehr gesehen hat. » Und im Inneren dieses Waldes sieht man dann auch keinen Fuchsbau mehr und keinen Dachsbau«, dort brüte keine Eule und auch kein Specht, weil den Tieren der Weg aus dem Wald einfach zu weit sei. Und hinaus müssten sie, um Futter zu finden. Fazit: »Der dichte Wald kann nicht der natürliche Lebensraum für unsere Fauna, Flora und Pilze gewesen sein.«
Es gab ihn ja auch nur als Ausnahmeerscheinung und auf größerer Fläche nur in einer erdgeschichtlich sehr kurzen Zeitspanne von ein paar tausend Jahren. In der Zeit nämlich, als unsere Vorfahren oder deren Verwandte, die Neandertaler, die großen Pflanzenfresser ausgerottet hatten, bis dann Homo sapiens aus dem Nahen Osten mit den dort domestizierten Rindern und dem neuen Wissen über die Landwirtschaft einwanderte. Und jetzt gibt es ihn wieder, seit wir vor zweihundert Jahren damit begonnen haben, die Weidetiere der Bauern aus dem Wald zu vertreiben.
Die Wälder, die dadurch entstanden sind, haben mit der ursprünglichen Natur Mitteleuropas nichts gemein. So viel steht für Jan Haft fest.
Naturschutz oder Landwirtschaft
Gerade dreht er, zusammen mit seiner Frau Melanie Haft, einen neuen Kinofilm über das Grasland. Das würde er gerne schützen, und zwar weltweit. Raus mit den Tieren aus den Ställen, sagt er: »Raus in die Landschaft, wo jede einzelne Kuh, die draußen weidet, eine positive Klima-Gesamtbilanz hat. Dann wäre wirklich dem Planeten substanziell geholfen. Wesentlich mehr, als wenn wir Naturschützer hier und da und dort uns knatternde Mähwerke kaufen, die mit Diesel befüllen und zwei Mal im Jahr über die Wiesen rattern.«
»Wir Naturschützer« hat Jan Haft gesagt. Man hört, dass er sich noch zugehörig fühlt – und man kann nachlesen, dass er sich sehr weit von der typischen Naturschutzidee entfernt hat, die letztlich einen bestimmten Zustand erhalten will und dafür ständig eingreift in eben die Natur, die sich alleine so gar nicht erhalten möchte, wie sich die Naturschützer das vorstellen.
Wie kam das, habe ich ihn gefragt, dass der gelernte Naturschützer Jan Haft heute so ganz anders über die Natur denkt, als viele seiner Kollegen?
Eigentlich sei er als Naturschützer aufgewachsen, sagt er. »Ich war als Kind schon in allen Vereinen tätig und Mitglied der bekannten Naturschutzvereine. Ich bin auf die Mitgliederversammlungen gegangen, zum Teil im Konfirmationsanzug und habe mitprotokolliert, was die schlauen Leute vorne sagen« Seinen Zivildienst hat er beim Landesbund für Vogelschutz abgeleistet. Zwanzig Monate waren das damals. Er möchte diese Zeit nicht missen, aber es kamen ihm schon damals erste Zweifel an seinem Tun. »Ich habe da diese Naturschutzhybris gelebt: Einerseits davon rede, dass die Natur unberührt sein soll und sich ohne Menschen am besten entwickelt. Aber unser tägliches Brot als Naturschützer war doch das Ackern und Pflanzen und Schneiden und Mähen und Abflämmen.«
Es hat lange gedauert, bis er diesen Widerspruch auflösen konnte, »denn von dem, was man zwanzig Jahre lang lernt und tut, trennt man sich nun mal nur schwer.«
Man kann das auch an seinen Veröffentlichungen sehen und in seinen Büchern nachlesen. Da gab es 2019 noch den Film »Die Wiese«, der mit dem Horst-Stern-Preis für den besten Naturfilm ausgezeichnet wurde, und das Buch dazu war Spiegel-Bestseller. Danach traf er Menschen wie die Weidespezialisten Margret Bunzel-Drüke und Edgar Reisinger und den Insektenforscher Herbert Nickel. »Innerhalb weniger Gespräche war mir dann klar, dass ich im Wiesenbuch und im Wiesenfilm nur die halbe, die Naturschutzwahrheit erzählt und durchdacht habe.« Am Ende wird die wunderbare Sommerwiese dann nämlich vom Naturschutz gemäht. Und das sei, egal wie extensiv man es betreibt, immer Landwirtschaft und niemals zu Ende gedachter Naturschutz.

Oder Naturschutz und Landwirtschaft
So kam es, dass der Naturfilmer Jan Haft dann auch in einer Landschaft gedreht hat, die es nur gibt, weil der Naturschutz hier zu Ende gedacht wurde – und das übrigens durchaus landwirtschaftlich: Stiftungsland Schäferhaus, ein ehemaliger Truppenübungsplatz bei Flensburg, der seit über 25 Jahren zur Ganzjahresweide geworden ist. Hier lebt eine Herde der robusten Galloway-Rinder und einige Koniks, die von den Wanderern immer gerne Wildpferde genannt werden. Die aus Polen stammenden Koniks sind aber ursprünglich Arbeitsponys. Konik heißt auf Deutsch schlicht Pferdchen.
Als ich zum ersten Mal eine kleine Herde Koniks in einer Weidelandschaft getroffen habe, war mir sofort klar, dass diese Pferdchen alles andere als wild sind. Im Gegenteil, sie sind auf Menschen geradezu fixiert. Sie kommen und wollen gestreichelt werden, oder auch nur nachschauen, ob etwas Essbares im Rucksack steckt.
Die Rinder und Pferde halten die Landschaft offen und bauen sie um zu einer »nordischen Savanne«. So bewirbt die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein das Gebiet inzwischen, das seit über einem Vierteljahrhundert von Bunde Wischen bewirtschaftet wird. Ja, bewirtschaftet, denn die Galloways sind eben der landwirtschaftliche Teil des Naturschutzes und Bunde Wischen — hochdeutsch Bunte Wiesen — ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft, die auch von der Verarbeitung und dem Verkauf des Fleischs lebt. Bei der Verarbeitung übrigens nach dem Prinzip »From Nose to Tail« – also des ganzen Tieres.
Diese Landschaft habe ich schon in dem Blog und dem Podcast »Besuch im Psychotop« vorgestellt, und den Betrieb und seine Arbeit dann in Blog und Podcast »Landwirtschaft als Naturschutz«; das dann inklusive Weideschuss. Denn Betriebsleiter und Genossenschaftsvorstand Gerd Kämmer, studierter Biologe wie Jan Haft, hat seinen Tieren das Versprechen gegeben, dass sie niemals in einem Tiertransporter enden und keinen Schlachthof sehen werden.
Jetzt habe ich ihn gefragt, was eigentlich aus dem Wald geworden ist, den einstmals die Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz zu Ausbildungszwecken für die Soldaten gepflanzt hatte.
»Ja«, sagt Gerd Kämmer, »der steht spannenderweise immer noch da. Die Förster sind immer völlig irritiert, dass es den noch gibt, denn in deren Theorie machen die Rinder ja alles kaputt.«
Deshalb musste Bunde Wischen damals, als die Genossenschaft den Truppenübungsplatz zum Weideprojekt machte, auch zum Ausgleich anderswo einen neuen kleinen Wald auf einen Acker pflanzen. Als Ausgleichsmaßnahme, denn Beweidung schädigt ja angeblich den Wald, weshalb die Waldweide in Deutschland auch nur mit Ausnahmegenehmigung machbar ist.
Und was ist nun geworden aus dem Übungswald der Bundeswehr? »Der ist natürlich artenreicher geworden«, sagt Gerd Kämmer, der von hause aus auch Biologe ist, wie Jan Haft. Die Weidetiere sorgen für offene Stellen im Wald, auch indem sie den Nachwuchs der Bäume fressen. Wenn dann ein Baum fällt, oder viele der Bundeswehr-Fichten gefällt werden, wie 2013 vom Orkan Christian, dann ist Platz für andere Pflanzen und viele Insekten, Amphibien, Kleinsäuger. Die Biodiversität folgt den Weidetieren in den Wald.

Wandernde Wälder
Es gibt auch Wälder, die von sich aus artenreich sind, Eichenwälder zum Beispiel. Auch davon hat Bunde Wischen einige in seinen inzwischen fast 1500 Hektar beweideten Naturschutzgebieten.
Womit wir bei der sprichwörtlichen deutschen Eiche wären. Die ist einer jener von Jan Haft erwähnten heimischen Baumarten, die in einem dichten Wald gar nicht leben können. Die Eiche braucht Licht und sie wächst sehr langsam. Den Wettlauf zum Licht verliert sie gegen die Buche allemal, weshalb es Mischwald aus Eiche und Buche nicht gibt. Wie konnte die Eiche denn dann zu dem Baum der Deutschen werden, wenn sie in den behaupteten flächendeckenden Hochwäldern nicht überleben kann?
»Ja, das fragt man sich«, sagt Gerd Kämmer. » Gibt es natürlicherweise überhaupt Eichenwälder hier bei uns in Mitteleuropa?« Wie konnte die Eiche zum Baum der Deutschen werden? Die Antwort ist einfach: Dafür sorgen die Weidetiere, die die Buchen kurzhalten und einige Verbündete der Eiche.
Jan Haft beschreibt das in seinem Waldbuch und anschauen kann man sich das auch in den halboffenen Weidelandschaften, die es inzwischen in Deutschland wieder gibt. Junge Eichen wachsen aus dem dornigen Gestrüpp, das Schlehe oder Weißdorn bilden. Diese Pflanzen reagieren auf den Verbiss durch die Weidetiere umgehend mit dem Austrieb von mehr und kräftigeren Dornen. So können sie sich behaupten und damit auch den Aufwuchs anderer Pflanzen schützen. Für den sorgt ein fleißiger Helfer der Eichen, der Eichelhäher. Er legt seinen Nahrungsvorrat gezielt am Fuß der Dornbüsche an, weil er die Eicheln dort sicher weiß vor gefräßigen Wildschweinen. Und natürlich findet er nicht alle gehorteten Eicheln wieder. So kann dann aus den Dornen eine junge Eiche wachsen, die, wenn sie groß genug ist, die Dornbüsche beschattet und zum Absterben bringt.
So kann ein regelrechter Eichenwald entstehen. Ein Wald, der niemals ein geschlossenes Kronendach bildet und deshalb vielen anderen Pflanzen und besonders vielen Tieren Lebensraum bietet. In einer ausgedehnten Weidelandschaft sind aber auch die lichten Eichenwälder nicht etwa ein Endprodukt der Natur. Auch sie vergehen wieder.
Nur wir Menschen könnten das nicht recht überblicken, sagt Gerd Kämmer, weil unsere Lebensspanne so viel kürzer ist, als die einer Eiche. Aber auch die der Eiche geht eben nach fünfhundert Jahren oder mehr einmal zu Ende. Wenn dann der Eichenwald zusammenbricht, sind aber vielleicht an anderer Stelle schon junge Eichen nachgewachsen. »Der Wald bleibt also nicht an einer Stelle, sondern er wandert durch die Weidelandschaft.«

Neuer Urwald?
Fünf Prozent der Wälder Deutschlands sollten aus der Nutzung genommen werden. Bis 2020, beschlossen von der Bundesregierung 2007 im Rahmen der Strategie zur biologischen Vielfalt. Naturwaldstrategie wird das auch genannt, immer der Ideologie folgend, dass man nur Natur Natur sein lassen müsse, damit alles wieder gut wird. Glücklicherweise ist das Fünf-Prozent-Ziel deutlich verfehlt worden.2020 waren es nur knapp drei Prozent der deutschen Wälder, die nicht mehr genutzt wurden.
In seinem Buch »Unsere Wälder« stellt uns Jan Haft einen äußerst artenreichen Wald vor, der voll in der Nutzung ist. Als krassesten Gegenentwurf zum artenarmen Urwald-Nationalpark stellt er uns einen sogenannten Mittelwald in Franken vor. Dort, im Stadtwald von Bad Windsheim, wird geholzt was das Zeug hält. Der Mittelwald ist eine sehr alte Form der Bewirtschaftung, bei der Kahlschlag und junges Dickicht nebeneinanderstehen, bei der aber auch alte Eichen stehen bleiben und abgesägte Baumkronen für die Käfer und Pilze liegen bleiben.
Dieser intensiv genutzte Wald ist einer der artenreichsten Deutschlands. Hier ersetzen Axt und Säge die fehlenden großen Weidetiere. Der Wald lässt immer Licht zum Boden durch. Das fördert die Blühpflanzen, die Insektenweiden.
»Urwald wäre gut« sagt Jan Haft, »Urwald ist was Feines, wenn der Urwald echter Urwald ist.« Nur werden aus unseren Wäldern keine Urwälder, wenn wir sie aus der Nutzung nehmen und sich selbst überlassen. »Das sind Flächen, auf denen die Biodiversität abnimmt. Die Artenvielfalt geht auf Talfahrt.«
Die Naturschützer, jene, zu denen Jan Haft und Gerd Kämmer nicht gehören, oder nicht mehr, nennen das Verfahren Prozessschutz. Die natürlichen Prozesse sollen wieder greifen. Das funktioniert aber nicht, wenn ein Teil der natürlichen Prozesse gar nicht mehr greifen kann, weil seine Protagonisten nicht mehr da sind. Man müsse dann eben entweder den fehlenden Prozess ersetzen, sagt Jan Haft, »oder man muss damit leben, dass die Artenvielfalt in einer sich selbst überlassenen sogenannten Urwaldfläche stark abnimmt.«
Weil die großen Weidetiere fehlen, die zu unserer natürlichen Landschaft immer gehört haben, bis unsere Vorfahren sie ausrotteten. Danach gehörten sie auch noch dazu, weil unsere etwas späteren Vorfahren sie durch ihre Nutztiere ersetzten. Erst im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Weidetiere dann aus den Wäldern verbannt.
Das, sagt Jan Haft, sollten wir unbedingt rückgängig machen. Und weil er nicht dafür plädiert das via Verordnung durchzusetzen, möchte er erst einmal damit beginnen, die Naturschützer von der Waldweide zu überzeugen. »Wir könnten unsere Naturschutzgebiete und Nationalparks, die zusammen vier Prozent der Landesfläche ausmachen, zumindest teilweise beweiden.« Statt in den sogenannten Kernzonen gar nichts mehr zu machen, lieber ein paar Weideflächen aufmachen, die die Biodiversität zurückholen. Auf dass es auch in unseren Wald-Nationalparken wieder so lebendig werde wie im fränkischen Mittelwald.
Außerdem plädiert Jan Haft dafür, dass auch die vielen kleineren Naturschutzgebiete und sogenannten Ausgleichsflächen, die derzeit mit aufwendigen Mähmaßnahmen und manuellem Beschnitt offengehalten werden, wieder beweidet werden. Dazu könnten sich die Kommunen doch neben ihrem Bauhof auch einen landwirtschaftlichen Hof halten, als Basis für einen Hirten, der mit seinen Tieren die Naturschutzflächen beweidet.

Mit Fördermitteln steuern
Die meisten Flächen in Deutschland sind aber nicht in der Hand des Naturschutzes, die meisten Flächen sind landwirtschaftlich genutzt. Die meisten Bäuerinnen und Bauern muss man auch nicht erst aufwendig davon überzeugen, dass Weidetiere etwas Positives sind. Die Tiere stehen zumeist im Stall, weil da mit Maschinen gearbeitet werden kann, weil Weidegang eben mehr Arbeit ist. Diese Mehrarbeit müsste halt bezahlt werden.
»Wir sollten die scharfen Grenzen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz einfach auflösen,« sagt Jan Haft. Der Natur sei es schließlich egal, ob die Weidetiere im Dienst der Landwirtschaft oder des Naturschutzes die Landschaft pflegen. »Die positiven Effekte einer extensiven Weide, idealerweise einer Ganzjahresweide, habe ich ja gleichermaßen auf einer Naturschutzfläche wie auf einer Landwirtschaftsfläche, wo ich halt Biofleisch oder Weidefleisch herstelle, das seine eigene Qualität hat.«
Wobei auch der Naturschutz am Ende schießen muss, oder »Tiere entnehmen«, wie es dann gerne euphemistisch heißt. Selbst in der Döberitzer Heide bei Berlin, einem der positiven Beispiele in Jan Hafts Buch, wird es irgendwann zu viele Wisente geben für das 3600 Hektar große Gebiet, das die Heinz-Sielmann-Stiftung betreibt. Dann werden wir wohl Wisent-Steaks essen müssen, oder dürfen. Denn verhungern sollen diese Tiere, die wir Menschen in Obhut genommen haben, ja wohl nicht.
Bei Bunde Wischen, wo fast 1500 Hektar Naturschutzgebiete beweidet werden, wird jede Woche auf der weide geschossen. Rund zweihundert Kälber Nachwuchs zeugen die gut tausend Rinder im Jahr. Für die müssen ältere Tiere geschossen werden, und gegessen dann natürlich auch.
Auf neunzig Milliarden ökologische Folgekosten, also Umwelt-, Reparatur und gesellschaftliche Kosten, hat die Zukunftskommission Landwirtschaft die jährliche Last der Landwirtschaft für Deutschland beziffert. Wenn wir davon auch nur einen Bruchteil in die Hand nehmen würden, um Weidelandschaft zu fördern, wäre viel geholfen. Jan Haft sieht eine gleich mehrfache Win-Situation in extensiver Weide. Zum Beispiel: Höchstes Tierwohl und maximal gesunder Nachwuchs.
Es ist noch nicht ganz zu Ende beforscht, aber es scheinen sich die Beobachtungen zu erhärten, dass die Weidetiere zumindest auf Ganzjahresweiden mit einer vielfältigen Pflanzengemeinschaft selbst für ihre Wurmkuren sorgen. Pferde fressen im zeitigen Frühjahr die giftigen Triebe der Herbstzeitlose, Rinder offenbar giftige Wolfsmilchgewächse. Selbstmedikation – das spart den Tierarzt und schützt die Insekten, die nach veterinärmedizinischen Wurmbehandlungen ansonsten im vergifteten Kuhfladen umkommen.
»Also, ich habe einen Kostenvorteil bei den Tierwohlkosten«, führt Jan Haft auf: »Ich habe ein sehr gutes Lebensmittel, das dort entsteht. Natürlich, bei so einer artenreichen Kost. Ich habe eine ästhetische Landschaft.« Ja, diese nordische Savanne finden die meisten Menschen schön, die Weidegebiete ziehen Wanderer magisch an.
Dann folgt der Klimaschutz. »Natürlich speichern heranwachsende Bäume sehr viel Kohlenstoff, aber wenn die Bäume groß sind, passiert oberirdisch nicht mehr viel.« Außerdem, das wissen wir aus der jüngsten Bundeswaldinventur, geht es dem deutschen Wald im Klimawandel so schlecht, dass er zur Kohlenstoffquelle geworden ist: er emittiert mehr CO2, als er aufnimmt. »Der einzige Kohlenstoff, der dauerhaft abgespeichert wird in einem Lebensraum, ist im Boden«, sagt Jan Haft. Humus besteht zu sechzig Prozent aus Kohlenstoff, den die Pflanzen zuvor aus der Luft genommen haben. Und: »Bei der Humusbildnerei sind beweidete Landschaften nach dem Moor die absoluten Champions und dem Wald überlegen.«
Wissen und Tun
Das sind schöne Ideen, die Jan Haft da ausbreitet. Und wahrscheinlich hat er recht, wenn er sagt, dass die Gesellschaft das mehrheitlich begrüßen würde. Ja, die Tiere sollen raus aus den Ställen, ja, die Landschaften, die sie gestalten, wenn man sie lässt, sind schön.
Aber nein, die Politik macht da nicht mit. Sie handelt ganz bewusst wider besseres Wissen. Gerade haben die Agrarminister der Länder die Bundesregierung gebeten, den Beschluss des Bundestages vom vergangenen Jahr, eine Weideprämie für Milchkühe als Ökoregelung festzulegen, wieder aus dem Gesetz streichen zu lassen.
Nicht einmal die Milchkühe sollen wieder raus auf die Weiden. Wie weit entfernt scheint da die Waldweide?
Gerd Kämmer bringt es auf den Punkt: »Die Erkenntnis ist da, man will sie aber nicht wissen. So scheint mir das zu sein.« Die Weideprojekte funktionieren – auch als Landwirtschaft. Das ist nun schon jahrzehntelang bewiesen. Dennoch bleiben sie eben Projekte und damit die Ausnahme.
Auch das Fleisch der robusten Weiderinder bleibt die Ausnahme und all die in Gläsern eingemachten Saucen und Suppen und Frikassees. Die von Bunde Wischen gibt es übrigens auch nicht via Internet, sondern nur in der Region. Nachschauen lohnt sich da nicht, Bunde Wischen liefert nur an die Läden der Region und verschickt nichts bundesweit, weil das den positiven Klimafußabdruck der Rinder und des ganzen Betriebs schmälern würde. Wer also so etwas probieren will und nicht in Schleswig-Holstein lebt, muss sich den Weidehalter vor Ort suchen.
Wenn Jan Hafts Buch über die mögliche Zukunft unserer Wälder so viele Leser findet, wie sein Bestseller über die die Wiese, dann werden vielleicht auch die Weideprojekte zahlreicher, die solche Lebensmittel herstellen können.